


Im Anschluss an die Tagung high noon? findet 2026 wieder das
19. Internationale, deutschsprachige Treffen der Trainer*innen und Berater*innen für Deeskalations- und Sicherheitsmanagement im Gesundheits- und Sozialwesen
statt.
Die Tagung „high noon?“ findet am 12. und 13. März 2026 in Wien statt.
Das Motto lautet:
„schaffen von sicheren orten – innen und außen – not:fall:schutz“
Die Referent*inneninformationen werden laufend aktualisiert.

Renate Brand ist Fachkrankenschwester in der Psychiatrie; Trainerin und interne Beraterin für Aggression und Gewalt im Gesundheitswesen – Connecting Deutschland; Ausbilderin für Trainer*innen und interne Berater*innen für Aggression und Gewalt im Gesundheitswesen – Connecting Deutschland; 2. Vorsitzende NAGS – Deutschland;
Tatort Gewaltschutzkonzepte – gemeinsame Ermittlungen …
Gewaltschutzkonzepte sollen sicherstellen, dass Einrichtungen im Gesundheits- und Sozialwesen nicht zu Tatorten für Klient*innen oder Mitarbeitende werden. Doch wie entwickelt man ein tragfähiges Konzept? Welche inhaltlichen Fragen müssen gestellt und beantwortet werden?
Eine Arbeitsgruppe von NAGS Deutschland hat sich in den vergangenen zwei Jahren intensiv mit dieser Thematik auseinandergesetzt und einen strukturierten Fragenkatalog erarbeitet. Dieser bildet die Grundlage des Workshops. Gemeinsam mit den Teilnehmenden werden zentrale Elemente eines Gewaltschutzkonzeptes anhand konkreter Praxisbeispiele erarbeitet und kritisch überprüft. Im Fokus steht dabei nicht nur die fachliche Relevanz einzelner Maßnahmen, sondern auch die Frage, ob die bestehenden Leitfragen ausreichend, praxisnah und zukunftsfähig sind. Ziel ist es, Impulse für die Weiterentwicklung von Gewaltschutz in Organisationen zu geben und Perspektiven für nachhaltige Umsetzung aufzuzeigen.

Mag. Katharina Butschek, MA ist Klinische und Gesundheitspsychologin, Supervisorin und Coach.
Seit 2020 in der Psychologischen Beratungsstelle des WIGEV tätig, leitet sie diese seit 2023. Beratung und Behandlung für WIGEV Mitarbeiter*innen und das Durchführen von Schulungen für Führungskräfte des WIGEV sind dort ihre Hauptaufgaben. Zudem leitet sie seit 2023 das Projekt „Psychische Erste Hilfe“ im WIGEV.
Davor war sie 7 Jahre im Anton Proksch Institut als klinische Psychologin in der Behandlung suchtkranker Patienten tätig.
Psychische Erste Hilfe
In der Psychologischen Beratungsstelle haben wir es immer wieder mit Klient*innen zu tun, die durch Ereignisse am Arbeitsplatz schwer mitgenommen sind. Der Umgang mit diesen betroffenen Personen war bislang recht unterschiedlich. Um schwerwiegende Folgen traumatisierender Ereignisse zu vermeiden, hat der Wiener Gesundheitsverbund 2022 begonnen, ein unternehmensweites Peer-System unter dem Namen „Psychische Erste Hilfe“ zu etablieren. Als Projektleiterin beschreibe ich die Entstehungsgeschichte kollegialer Hilfe im WIGEV, die notwendigen Rahmenbedingungen, den Fortschritt und den Status Quo des Projekts.
Psychische Erste Hilfe
Im Workshop werden wir einen Blick auf traumatische Krisen und deren Folgen werfen. Wir beleuchten, welche Unterstützung Psychische Erste Hilfe bieten kann und wo ihre Grenzen sind. Wir können die Details des Projekts genauer betrachten und förderliche und hinderliche Aspekte herausarbeiten. Ich beantworte auch gerne alle Fragen, die zu diesem Thema aufkommen.
![Eder[41].JPG Eder[41].JPG](https://www.pflegenetz.at/wp-content/uploads/2023/02/Eder41.JPG.jpeg)
Forensic Nursing/Gewaltambulanzen „Opferschutzarbeit Praxisrelevant“
Eine von drei Frauen in der EU hat im Laufe ihres Lebens körperliche Gewalt oder Drohungen und/oder sexuelle Gewalt erlebt. Dies stellt ein erhebliches gesellschaftliches und gesundheitliches Problem dar – Krankenhäuser sind dabei zentrale Anlaufstellen, an denen Opfer von physischer, psychischer und sexueller Gewalt erstmals oder wiederholt in Erscheinung treten. Die adäquate Versorgung dieser Menschen erfordert nicht nur medizinische Expertise, sondern auch ein umfassendes System aus Prävention, Schutzmaßnahmen, psychosozialer Unterstützung und interdisziplinärer Zusammenarbeit. Der Workshop soll einen Überblick über aktuelle Herausforderungen, Standards und Best-Practice-Modelle im Bereich Opferschutz im Krankenhaus geben, die Rolle der verschiedenen Berufsgruppen zu beleuchten und konkrete Handlungsempfehlungen darzulegen.

Leiter der Fachgruppe „Aggressions- und Deeskalationsmanagement der Klinik f. forensische Psychiatrie u. Psychotherapie | §63“ (ADMfor63) am kbo-Isar-Amper-Klinikum Region München; Haar bei München
Johannes Edel, M.Sc., Pflegefachmann und Advanced Nurse Practitioner (ANP) am kbo-Isar-Amper-Klinikum Region München, studierte Pflegemanagement (B.A.) und ANP (M.Sc.) mit Schwerpunkten in Change-Management, Ethik und digitalem Wissensmanagement. Bis 2023 managte er ein Pilotprojekt „Safewards in der Forensik“ in Kooperation mit dem Bay. Amt für Maßregelvollzug und leitet derzeit eine Fachgruppe „Aggressions- und Deeskalationsmanagement“ im Bereich der forensischen Psychiatrie. Als freiberuflicher Dozent publiziert er regelmäßig zu Safewards, Gewaltprävention und Veränderungsprozessen in der psychiatrischen Pflege. Aktuell promoviert er zum Sicherheitsempfinden Pflegender im Maßregelvollzug.
Alles nur geklaut? – was wir von 3LK, high noon? und anderen mitgenommen haben
Gute Ideen zu „klauen“ ist manchmal die beste Form der Innovation: Seit über einem Jahrzehnt wird in den Forensischen Kliniken am kbo-Isar-Amper-Klinikum Region München das Aggressions- und Deeskalationsmanagement kontinuierlich weiterentwickelt. Was als einzelne Schulungen begann, hat sich zu einer lebendigen mit inzwischen 14 Projekten entwickelt. Dabei wurden zahlreiche Projektideen aus Kongressbegegnungen und wissenschaftlichen Diskursen übernommen und für die forensische Pflege adaptiert – ein bewusster Transfer erfolgreicher Konzepte in das spezielle Setting. Organisatorisch war den Machern dabei wichtig, dass die jeweiligen Projektleiter*innen weiter in die klinische Versorgung eingebunden bleiben und so einen hohen Praxisbezug sicherstellen können. Der Beitrag zeigt, wie durch Austausch, Evidenzorientierung und Engagement nachhaltige Innovation im Aggressions- und Deeskalationsmanagement entstehen kann.
Tatort Gewaltschutzkonzepte – gemeinsame Ermittlungen für wirksamen Gewaltschutz
Gewaltschutzkonzepte sollen sicherstellen, dass Einrichtungen im Gesundheits- und Sozialwesen nicht zu Tatorten für Klient*innen oder Mitarbeitende werden. Doch wie entwickelt man ein tragfähiges Konzept? Welche Fragen müssen beantwortet werden? Eine Arbeitsgruppe von NAGS Deutschland hat sich im vergangenen Jahr intensiv mit dieser Thematik beschäftigt und einen strukturierten Fragenkatalog erarbeitet, der die Grundlage des Workshops bildet. Gemeinsam mit den Teilnehmenden werden zentrale Elemente eines Gewaltschutzkonzeptes anhand konkreter Praxisbeispiele erarbeitet und kritisch überprüft. Der Fokus liegt nicht nur auf der fachlichen Relevanz einzelner Maßnahmen, sondern auch auf der Frage, ob die bestehenden Leitfragen ausreichend und praxisnah sind. Ziel des Workshops ist es, Impulse für die Weiterentwicklung von Gewaltschutz zu geben und Perspektiven für eine nachhaltige Umsetzung aufzuzeigen.

Carolin Fischer leitet das strategische Themenfeld Caring Society an der Berner Fachhochschule. Daneben ist sie Dozentin am Departement Soziale Arbeit, Institut soziale und kulturelle Vielfalt.
In einem kürzlich abgeschlossenen Projekt mit dem Titel «Violent Safe Havens? Exploring Articulations and Repercussions of Violence in Refugee Reception and Settlement» beforschte sie, welche Auswirkungen Flucht- und Gewalterfahrungen auf die Lebensverläufe Geflüchteter und auf Dynamiken in unterschiedlichen Sozialräumen haben. In ihrer aktuellen Forschung geht es um Perspektiven für eine sozial, ökologisch und wirtschaftlich nachhaltige Baukultur von Unterkünften für geflüchtete Menschen.
Asyl: Unsicherheit statt Schutz? Die Alltagserfahrungen Geflüchteter besser verstehen
Wie sieht das Leben geflüchteter Personen aus, die das Asylverfahren durchlaufen und einen rechtlichen Schutzstatus erhalten haben? Asyl impliziert die Erfahrung von Gewalt in der Vergangenheit. Gewalt ist gewissermassen die Grundlage oder Voraussetzung dafür, dass einer Person Asyl gewährt wird. Aber fördert Asyl im Umkehrschluss einen Zustand der Gewaltfreiheit beziehungsweise die Möglichkeit einer Erholung von erfahrener Gewalt? Wie hängen erlebte
Sicherheit und Solidarität zusammen? Und wie ist Sicherheit räumlich und sozial verortet?
Dieser Vortrag basiert auf Erkenntnissen aus dem abgeschlossenen Forschungsprojekt «Das Zusammenspiel von Schutz und Gewalt im Kontext von Flucht und Asyl». Es werden Alltagserfahrungen Geflüchteter in Norwegen und der Schweiz beleuchtet um das jeweils erlebte Wechselspiel von Schutz und Gewalt zu verstehen und es in grösseren Zusammenhängen einzubetten.

Psychiatrisches Diplom Abschluss 2004
Trainerausbildung Deeskalation und Sicherheitsmanagement 2015.
Nach Ausbildung als Trainer des Kepler Uniklinikums in Linz tätig.
Seit 2019 bin ich in der Stabstelle für Sicherheits- und Deeskalationsmanagement am Kepler Uniklinikum tätig.
Trainings gestalte ich zudem für alle Sparten der Gesundheitsberufe (FH-Studium Bachelor, PFA und PA.
Seit 2023 Obmann von NAGS Austria.
![Sabine Hahn[62] Kopie Sabine Hahn[62] Kopie](https://www.pflegenetz.at/wp-content/uploads/2023/02/Sabine-Hahn62-Kopie.jpg)
Sabine Hahn ist Professorin für Pflege und Expertin für psychiatrische Pflege. Sie promovierte in Gesundheits- und Pflegewissenschaft an der Universität Maastricht (NL) zum Thema Aggression im Gesundheitswesen. Ihr Fokus liegt auf Umgebungsfaktoren, Beziehungsgestaltung, Aggression, Zwang sowie Sicherheit im Gesundheitswesen. Seit 2012 leitet sie den Fachbereich Pflege der Berner Fachhochschule (CH), ist Gastprofessorin an der Universität Bournemouth (UK) und Präsidentin des Schweizer Vereins für Pflegewissenschaft.
Aggression und Zwang über die Jahre – Fake News?
Aggression und Zwang – gefühlt nimmt beides ständig zu. Schlagzeilen, persönliche Eindrücke und der Flurfunk zeichnen ein bedrohliches Szenario. Doch beruhen diese Wahrnehmungen auf Fakten oder doch Fake News? Großangelegte Befragungen im Wiener Gesundheitsverbund 2019 und 2022 zeigen: Die Prävalenz von Aggressionsereignissen blieb erstaunlich stabil – auch während der Pandemie und das trotz gegenteiliger Medienberichte. Was sich veränderte, sind Wahrnehmung, Belastung und Folgen für die Mitarbeitenden. Besonders betroffen sind Pflege, Notfallmedizin und Psychiatrie, wobei verbale Aggression oft belastender wirkt als körperliche Übergriffe. Lösungen bieten sich nur an, wenn Herausforderungen sachlich und faktenbasiert besprochen werden, d.h. der Herausforderung einen Namen geben und darüber frei sprechen (versus polemisierend und/oder tabuisierend). Der Vortrag fokussiert das Spannungsfeld zwischen gefühlten Wahrheiten und empirischer Evidenz und macht aufmerksam, wie wichtig es ist, die Bedrohungsgefühle ernst zu nehmen. Aufgezeigt wird auch wie Prävention, Training und Haltung einen Unterschied machen können.

Dr.in Susanne Hölbfer ist Oberärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe, ärztliche Kreissaalleitung und Leiterin der Opferschutzgruppe in der Klinik Ottakring. Sie setzt sie sich für die Prävention und Versorgung von häuslicher und sexualisierter Gewalt sowie für die Verhinderung von Gewalterfahrungen während des Geburtsvorganges ein. Weiters ist sie Mitglied des FGM-Expertinnenbeirates der Stadt Wien und leitet die Ambulanz für von FGM/C-Betroffene in der Klinik Ottakring.
Opferschutzarbeit Praxisrelevant
Eine Einführung in die Risikofaktoren, die Situation Betroffener und die Folgen von Gewalt unter spezieller Berücksichtigung der Rolle des Gesundheitssystems. Wie können wir Gewalt ansprechen und was passiert, wenn wir es tun? Wie können wir helfen, was sind unsere rechtlichen Möglichkeiten und Pflichten? Welche Sicherheitsaspekte sind zu bedenken, wenn wir mit Gewaltopfern zu tun haben? Fragen, die im klinischen Alltag oft überfordern sollen hier aufgearbeitet und beantwortet werden.
Paul Hoff, Jahrgang 1956, studierte Humanmedizin und Philosophie. Er habilitierte sich 1994 in München mit einer Arbeit über Emil Kraepelin. Von 1997 bis 2003 war er Professor für Sozialpsychiatrie an der RWTH Aachen, von 2003 bis zum Altersrücktritt 2021 Chefarzt an der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich. Seither betreibt er eine Sprechstunde an der Privatklinik Hohenegg in Meilen. Seit 2021 ist er Präsident der Zentralen Ethikkommission (ZEK) der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW).
Seine Arbeitsschwerpunkte sind Wissenschaftstheorie und Geschichte der Psychiatrie, Psychopathologie, Diagnostik sowie ethische Herausforderungen des Faches.
Zwang und Gewalt im Sozial- und Gesundheitswesen: Die ethische Dimension
Zwang und Gewalt sind Phänomene, die (auch) im Sozial- und Gesundheitswesen existieren und mit denen wir uns als Fachpersonen daher beschäftigen müssen. Sie konfrontieren uns jedoch regelmässig mit zwei markanten ethischen Dilemmata:
– Auf der Ebene Patienten/-innen: Respekt vor der Autonomie einerseits, Verpflichtung zur Fürsorge andererseits
– Auf der Ebene der Fachpersonen: Berufliches Selbstverständnis einerseits, mitunter nicht vermeidbare Anwendung von Zwang andererseits
Der Vortrag arbeitet diese Spannungsfelder mit praktisch-klinischen Bezügen heraus.

Ludger Hoffkamp lebt in Ludwigsburg. Er studierte Kath. Theologie in Tübingen und Würzburg, ist Kath. Seelsorger mit großer Erfahrung in Trauerbegleitung. Seine Ausbildung als Clown begann er vor 20 Jahren in Tübingen am Kindertheater Theo Tiger, in Berlin, Bonn und Wien an der Internationalen Schule für Humor und bei vielen Clowns der internationalen Szene. Er ist Clown, Zauberer, Moderator und fast 25 Jahre Klinikclown und Humorcoach bei der Stiftung „Humor hilft heilen“ (Eckart v. Hirschhausen) und gibt seit über 10 Jahren Seminare zu den Themen „Humor in der Pflege“, „Humor in der Kommunikation“, Humor angesichts von Trauer und Sterben“.
Zudem ist er Gestalttrainer (IGBW).
Lächeln statt Eskalieren – Humor und Humortraining als Präventionsstrategie –
Wirkungen auf den inneren sicheren Ort und den äußeren sicheren Raum
Humor galt bisher selten als ernstzunehmende Strategie im Deeskalationskontext. Genau hier setzt dieser Impulsvortrag an: ein adaptiver Humorstil – verstanden als respektvolle, verbindende Haltung – kann Spannungen entschärfen und Beziehung stärken.
Aufgezeigt werden anerkannte Strategien und Quelltheorien des Aggressions- und Deeskalationsmanagements und praktische Beispiele aus dem schon mehrere Jahre praktizierten Ausbildungsmodul „Humor in der Pflege“ der Stiftung von „Humor-hilft-Heilen“ (E. von Hirschhausen). Der Vortrag zeigt auf, welche Rolle der Humor und die positive Psychologie präventiv als auch in der Intervention bewirken kann. Besonders in den Blick genommen werden dabei Wirkungen auf den „inneren sicheren Ort“ und den „äußeren sicheren Raum“ für Mitarbeitende und damit auch für Klient:innen. Der Beitrag lädt ein, – über eine verwendete Clownsnase hinaus – mitten im professionellen Alltag Humor als Ressource für Deeskalationsmanagement neu zu denken.
Humor hilft heilen – die Bedeutung der positiven Psychologie in der Pflege
Freude und Humor in der Kommunikation eröffnet Spielräume zur Deeskalation von Konflikten und schafft Sicherheit. Schon ein Lächeln oder ein Miteinander-Lachen schafft eine emotionale Basis. Eine Situation die ernst ist, nicht nur ernst zu nehmen hilft uns im zwischenmenschlichen und professionellen pflegerischen, therapeutischen und medizinischen Kontakt.
Humor ist dabei weniger eine Technik, als vielmehr eine Haltung. Erkenntnisse der Hirnforschung und der Spiegelneurone bilden den Hintergrund des Workshops. Humorinterventionen können dabei respektvoll eingesetzt werden, um Menschen auch in Krisensituationen auf emotionaler Ebene positiv zu begegnen. Auf dem Hintergrund der Neurobiologie und der Kommunikationswissenschaften lernen die Teilnehmer*innen, sich in verblüffenden und teilweise clownesken Übungen auf andere Menschen und Situationen einzustellen und so eine offene und menschliche Haltung einzuüben. So kann Stress verringert und konstruktiv begegnet werden.

Tieni Moser, ist Berufsschullehrer für Pflege, Pflegeexperte HöFa II und Trainer Aggressionsmanagement NAGS. Seit 2006 ist er Co-Leiter des Trainerlehrganges Aggressionsmanagement im Gesundheits- und Sozialwesen. Seit 2014 Präsident des Vereins NAGS Schweiz. Neben diversen Lehraufträgen ist er im Bereich der konzeptuellen Entwicklung und Schulungen im Aggressionsmanagement tätig.
DEESK CH – ein Rahmenmodell und Trainingskonzept für die Deeskalation
DEESKalation CH ist ein stufenbasiertes Deeskalationsmodell und umfasst grundlegende, evidenzbasierte Prinzipien/Phasen der verbalen und nonverbalen Deeskalation. Im Referat werden das Modell und die damit verknüpften Trainingsmethoden zur Deeskalation vorgestellt und mit Beispielen zur konkreten Umsetzung unterlegt. Die Emotionsregulation und Empathie werden als wichtige Prinzipien bei der Begegnung mit Menschen mit herausforderndem Verhalten vertieft.
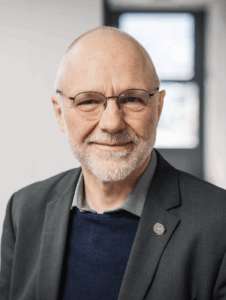
Johannes Nau, geb. 1959, lebt in Stuttgart/Ludwigsburg (D). Er ist Gesundheits- und Krankenpfleger und Diplom-Pflegepädagoge. Als Pflegewissenschaftler (Dr. rer. cur.) hat er international in zahlreichen Belangen des Aggressions- und Deeskalationsmanagements mitgewirkt. Bis zu seinem Ruhestand im Sommer 2025 leitete er das Evang. Bildungszentrum für Gesundheitsberufe in Stuttgart. Die Auszubildenden werden dort seit rund 20 Jahren in Deeskalationsmanagement unterrichtet. Seit 7 Jahren werden dort sämtliche Schulklassen nach dem Curriculum von „Humor hilft Heilen“ (Dr. Eckart von Hirschhausen) trainiert.
Lächeln statt Eskalieren – Humor und Humortraining als Präventionsstrategie –
Wirkungen auf den inneren sicheren Ort und den äußeren sicheren Raum
Humor galt bisher selten als ernstzunehmende Strategie im Deeskalationskontext. Genau hier setzt dieser Impulsvortrag an: ein adaptiver Humorstil – verstanden als respektvolle, verbindende Haltung – kann Spannungen entschärfen und Beziehung stärken.
Aufgezeigt werden anerkannte Strategien und Quelltheorien des Aggressions- und Deeskalationsmanagements und praktische Beispiele aus dem schon mehrere Jahre praktizierten Ausbildungsmodul „Humor in der Pflege“ der Stiftung von „Humor-hilft-Heilen“ (E. von Hirschhausen). Der Vortrag zeigt auf, welche Rolle der Humor und die positive Psychologie präventiv als auch in der Intervention bewirken kann. Besonders in den Blick genommen werden dabei Wirkungen auf den „inneren sicheren Ort“ und den „äußeren sicheren Raum“ für Mitarbeitende und damit auch für Klient:innen. Der Beitrag lädt ein, – über eine verwendete Clownsnase hinaus – mitten im professionellen Alltag Humor als Ressource für Deeskalationsmanagement neu zu denken.
Humor hilft heilen – die Bedeutung der positiven Psychologie in der Pflege
Freude und Humor in der Kommunikation eröffnet Spielräume zur Deeskalation von Konflikten und schafft Sicherheit. Schon ein Lächeln oder ein Miteinander-Lachen schafft eine emotionale Basis. Eine Situation die ernst ist, nicht nur ernst zu nehmen hilft uns im zwischenmenschlichen und professionellen pflegerischen, therapeutischen und medizinischen Kontakt.
Humor ist dabei weniger eine Technik, als vielmehr eine Haltung. Erkenntnisse der Hirnforschung und der Spiegelneurone bilden den Hintergrund des Workshops. Humorinterventionen können dabei respektvoll eingesetzt werden, um Menschen auch in Krisensituationen auf emotionaler Ebene positiv zu begegnen. Auf dem Hintergrund der Neurobiologie und der Kommunikationswissenschaften lernen die Teilnehmer*innen, sich in verblüffenden und teilweise clownesken Übungen auf andere Menschen und Situationen einzustellen und so eine offene und menschliche Haltung einzuüben. So kann Stress verringert und konstruktiv begegnet werden.

Helen Oehy ist Pflegefachfrau HF Psychiatrie, Ausbildnerin SVEB 2, Trainerin Aggressionsmanagement der ersten Stunde, Führungsfachfrau in Gesundheitsorganisationen (NDS), Master of Coaching (CAS) sowie Masterpractitioner & Instructor in Logosynthese® (LIS).
Helen Oehy, geb. 1966, wohnt in der Schweiz. Ihr Interesse an Menschen und deren Psyche steht und stand auf ihrem gesamten beruflichen und persönlichen Weg im Mittelpunkt. Als Coach begleitet sie Mitarbeitende in Gesundheitseinrichtungen sowie Privatpersonen in anspruchsvollen Berufs- oder Lebenssituationen. Mit Begeisterung vermittelt sie in Einführungskursen Logosynthese® für Selbstcoaching.
Logosynthese®: Ein Modell für Selbstregulation, Selbstwirksamkeit und Selbstcoaching
Gesundheitspersonal benötigt wie kaum eine andere Berufsgruppe die Fähigkeit, belastende Situationen zu verarbeiten und Stress, Druck oder Angst wirksam zu reduzieren. Einen sicheren Ort im Innen schaffen, um im Aussen Schutz zu bieten.
Logosynthese bietet einen innovativen und nachhaltigen Ansatz für:
Logosynthese® ist ein ganzheitliches Modell welches durch gezielte sprachliche Interventionen emotionale und energetische Blockaden löst und nachhaltige Veränderung ermöglicht.

Florian Schimböck, MSc, MEd, DGKP ist Pflegewissenschaftler, Pflegepädagoge, diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger, Praxisanleiter und Simulationstrainer in der Arbeitsgruppe Didaktik der Pflege und Gesundheitsberufe der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Seine Forschungsschwerpunkte umfassen Delir, Demenz, Simulation, E-Learning und Künstliche Intelligenz. Er ist Mitglied der Expert*innen-Arbeitsgruppe Delir des Deutschen Netzwerks für Qualitätsentwicklung in der Pflege (DNQP).
Delir im Fokus: Aktuelle Zahlen, Interventionen und Barrieren in der DACH-Region
Ziel des Vortrags ist es, ein umfassendes Update zum aktuellen Stand der Delirversorgung in der DACH-Region (Deutschland, Österreich und Schweiz) zu bieten. Zunächst werden die neuesten Prävalenzdaten aus verschiedenen Versorgungsbereichen vorgestellt, um ein differenziertes Bild in unterschiedlichen klinischen Settings zu zeichnen. Anschließend erfolgt eine detaillierte Analyse des Delirmanagements, wobei zentrale Instrumente zur Delirerkennung – etwa standardisierte Screening- und Assessment-Tools – sowie bereits eingesetzte präventive und (pflege‑)therapeutische Maßnahmen im Versorgungsalltag beleuchtet werden. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den strukturellen und organisatorischen Barrieren, die eine gute Delirversorgung erschweren. Abschließend werden daraus Empfehlungen abgeleitet, die auf eine verbesserte interprofessionelle Zusammenarbeit und die Weiterentwicklung praxisorientierter Interventionen abzielen.

Harald STEFAN, PhD., MSc.
Trainer für Deeskalationsmanagement
Doktor Phil. Pflegewissenschaft
Dipl. Ges. und Krankenpfleger
Mensch, Freund und Lebensbegleiter
Aggression und Zwang über die Jahre – Fake News?
Aggression und Zwang – gefühlt nimmt beides ständig zu. Schlagzeilen, persönliche Eindrücke und der Flurfunk zeichnen ein bedrohliches Szenario. Doch beruhen diese Wahrnehmungen auf Fakten oder doch Fake News? Großangelegte Befragungen im Wiener Gesundheitsverbund 2019 und 2022 zeigen: Die Prävalenz von Aggressionsereignissen blieb erstaunlich stabil – auch während der Pandemie und das trotz gegenteiliger Medienberichte. Was sich veränderte, sind Wahrnehmung, Belastung und Folgen für die Mitarbeitenden. Besonders betroffen sind Pflege, Notfallmedizin und Psychiatrie, wobei verbale Aggression oft belastender wirkt als körperliche Übergriffe. Lösungen bieten sich nur an, wenn Herausforderungen sachlich und faktenbasiert besprochen werden, d.h. der Herausforderung einen Namen geben und darüber frei sprechen (versus polemisierend und/oder tabuisierend). Der Vortrag fokussiert das Spannungsfeld zwischen gefühlten Wahrheiten und empirischer Evidenz und macht aufmerksam, wie wichtig es ist, die Bedrohungsgefühle ernst zu nehmen. Aufgezeigt wird auch wie Prävention, Training und Haltung einen Unterschied machen können.

Susanne Tosch, leitet seit über drei Jahren die Beratungsstelle Leuchtturm Demenz, Breitenbach, Schweiz und die eigene Firma Mütos Aggressionsmanagement seit 18 Jahren. Seit 2008 ist sie in der Co-Leitung des Trainerlehrganges Aggressionsmanagement im Gesundheits- und Sozialwesen tätig.
Frühere Tätigkeiten: Leitung Pflege & Betreuung Zentrum Passwang, Breitenbach und in der Psychiatrischen Klinik in Liestal, Schweiz
Aus- und Weiterbildungen: CAS Universität Zürich Beratungskompetenz zum Leben im Alter
Verbale Deeskalation nach DEESK CH & ProDeMa®
Diplomierte Pflegefachfrau HF, WPI Managementausbildung im Gesundheitswesen
DEESK CH – ein Rahmenmodell und Trainingskonzept für die Deeskalation
DEESKalation CH ist ein stufenbasiertes Deeskalationsmodell und umfasst grundlegende, evidenzbasierte Prinzipien/Phasen der verbalen und nonverbalen Deeskalation. Im Referat werden das Modell und die damit verknüpften Trainingsmethoden zur Deeskalation vorgestellt und mit Beispielen zur konkreten Umsetzung unterlegt. Die Emotionsregulation und Empathie werden als wichtige Prinzipien bei der Begegnung mit Menschen mit herausforderndem Verhalten vertieft.

Heidi Zeller ist Professorin für Dementia Care am Kompetenzzentrums Demenz des IGW Institut für Gesundheitswissenschaften an der OST – Ostschweizer Fachhochschule in St. Gallen (CH). Sie ist diplomierte Pflegefachfrau und Trainerin für Aggressionsmanagement. In der Forschung und Lehre liegt ihr Fokus auf Praxisentwicklung, Aggression, Gewalt und herausforderndem Verhalten im Bereich Dementia Care.
Wenn Nähe kippt: Gewalt in Pflegebeziehungen und Wege zur Prävention in der Langzeitpflege
Gewalt in Pflegeheimen kann zwischen Pflegenden und Bewohnenden, wie auch unter Bewohnenden selbst auftreten. Risikofaktoren sind z. B. vulnerable Bewohnende, hohe Arbeitsbelastung sowie zu wenig Sensibilisierung und Kompetenz bezüglich des Themas. Auch die physische und emotionale Nähe in Pflegesituationen kann Gewalt begünstigen.
Im Rahmen einer Studie erhielten wir Einblicke in die Dynamik von Gewalt in Pflegeheimen. Es wurde deutlich, dass Gewalt und Missbrauch in Pflegeheimen trotz des gestiegenen Bewusstseins weiterhin ein Problem sind: Viele Vorfälle werden nicht gemeldet, als «normal» betrachtet oder in den bestehenden Strukturen unzureichend berücksichtigt.
Um gegenzusteuern, braucht es neben Schulungsangeboten ein Zusammenspiel auf mehreren Ebenen: Sensibilisierung der Mitarbeitenden, offene Reflexion im Team sowie Strukturen, die Meldungen, ethische Reflexion und gute Führung fördern.
2026 findet die Veranstaltung im Austria Trend Hotel Schloss Schönbrunn statt.
Austria Trend Parkhotel Schönbrunn
Hietzinger Hauptstr. 10-14, 1130 Wien Österreich
Wir empfehlen das Parkhotel Schönbrunn
TeilnehmerInnen können sich gerne jederzeit zur Tagung anmelden.
Die entrichtete Tagungsgebühr gilt als Bestätigung für die Anmeldung zur Tagung. Jede*r angemeldete Teilnehmer*in erhält per E-Mail eine Bestätigung der Anmeldung. Die offizielle Registrierung gilt bei Einlangen der vollen Kongressgebühr als abgeschlossen.
vor dem 01. Dezember 2025
Kostenlose Stornierung
vom 01. Dezember – 31. Dezember 2025
Es fällt eine Bearbeitungsgebühr von 150,- Euro an
Nach dem 31. Dezember 2025
Keine Kostenrückerstattung
Unabhängig vom Zeitpunkt der Stornierung gilt: Sie können eine andere Person für die Tagung anmelden. Alle akzeptierten Rückvergütungen werden nach der Tagung rückerstattet. Im Falle einer Nichtdurchführbarkeit der Präsenzveranstaltung behält das gekaufte Ticket seine Gültigkeit für die Online-Tagung.
Im sehr unwahrscheinlichen Falle des Auftretens außerordentlicher Ereignisse (etwa Naturkatastrophen, durch die Staatsmacht verhängter Ausnahmezustand, kriegerische Ereignisse), die außerhalb der Kontrolle der Tagungsorganisation liegen, bleibt es pflegenetz vorbehalten, die Tagung und/oder die damit direkt oder indirekt verbundenen Tätigkeiten (etwa Veranstaltungen) unmittelbar abzusagen. In einem solchen Falle können keine Entschädigungen für damit entstandenen Schäden gewährt werden. Ferner kann die Tagungsorganisation – mit Ausnahme von etwaiger vorsätzlicher Schädigung oder grober Fahrlässigkeit durch pflegenetz – für direkte oder indirekte durch die TagungsteilnehmerInnen erlittenen Schäden inklusive Folgeschäden und nicht materiellen Schäden nicht haftbar gemacht werden.
Ihre eingegebenen Daten werden nur für den Zweck Ihrer Anmeldung zum und Teilnahme an der Tagung „high noon?“ verwendet. Sie werden nicht für Werbezwecke an Dritte weitergegeben. Bitte lesen Sie auch die detaillierten Datenschutzhinweise.
Hier können Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen herunterladen.
Baumeistergasse 32/5/1
1160 Wien, Österreich
E: office(at)pflegenetz.at
M: +43 699 104 613 14
T: +43 1 897 21 10
Mit unserem Newsletter informieren wir Sie
1x monatlich über Aktuelles, Neues und Wissenswertes aus dem Gesundheits-, Pflege- und Sozialbereich.
© pflegenetz 2023
